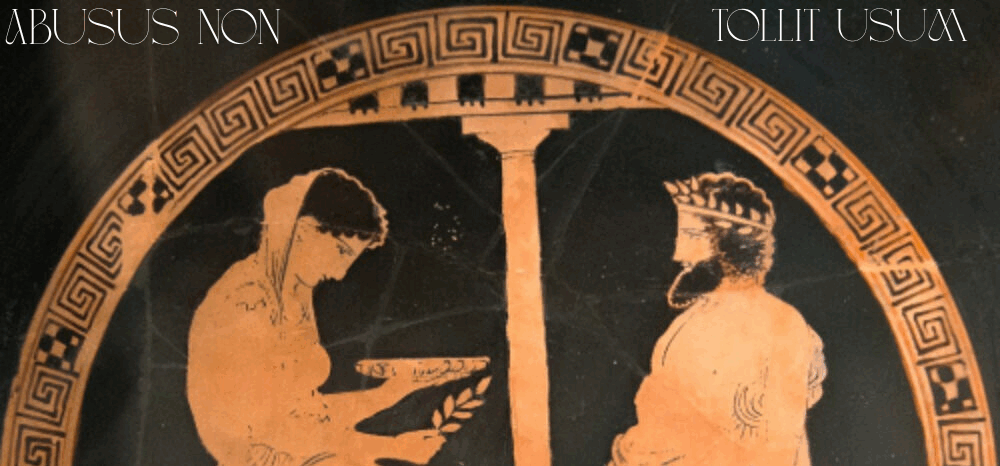Gern! Nehmen wir als Beispiel das Gendern in der deutschen Sprache – eine der prominentesten Entwicklungen im Zuge sprachlicher Neutralisierung.
Ausgangssituation:
Traditionell wird im Deutschen oft das generische Maskulinum verwendet:
„Alle Studenten müssen ihre Hausarbeiten abgeben.“
Hier sind laut klassischem Sprachgebrauch auch Studentinnen gemeint, aber sie werden nicht sprachlich sichtbar.
Ziel der sprachlichen Veränderung:
Man möchte alle Geschlechter sichtbar machen, z. B. durch:
-
Doppelnennung: „Studenten und Studentinnen“
-
Genderstern: „Student*innen“
-
Gendergap: „Student_innen“
-
Neutralisierung: „Studierende“
Vorteile dieser Veränderung:
-
Inklusion: Frauen, nicht-binäre Menschen und andere Geschlechtsidentitäten werden sprachlich sichtbar.
-
Bewusstsein: Sprache beeinflusst Denken – wer ständig nur von „Ärzten“ hört, stellt sich eben oft auch nur Männer vor.
-
Gerechtigkeit: Sprache wird der Vielfalt der Gesellschaft besser gerecht.
Herausforderung für komplexes Denken:
Hier wird es spannend:
1. Verlust an sprachlicher Präzision
„Studierende“ meint alle, die gerade studieren – aber nicht jene, die das mal getan haben oder in der Rolle eines „Studenten“ auftreten.
Ein Satz wie:
„Die Studentenbewegung der 60er-Jahre hat das politische Klima nachhaltig verändert“
klingt mit:
„Die Studierendenbewegung der 60er-Jahre“
sprachlich seltsam – denn die Bewegung ist längst vorbei.
2. Stilistische Einschränkungen
Texte, die stark gegendert sind, können an Rhythmus, Lesbarkeit und Ästhetik verlieren – z. B. in Lyrik, Rhetorik oder literarischen Werken:
„Ein jeder Mensch sei seines Glückes Schmied.“
→ „Jeder Mensch sei seines oder ihres Glückes Schmied*in.“ – verliert Sprachfluss.
3. Überkompensation kann Unklarheit stiften
Wenn ständig umformuliert wird, um neutral zu bleiben, können Inhalte schwammig werden:
„Alle, die in der Lehre tätig sind, sollen…“
– klingt neutral, ist aber unpräzise: Geht es um Lehrer? Dozenten? Ausbilder?
Fazit zum Beispiel Gendern:
Das Gendern erweitert den sprachlichen Raum in Bezug auf soziale Sichtbarkeit, kann aber in bestimmten Kontexten (Philosophie, Wissenschaft, Literatur) die sprachliche Differenzierung oder Eleganz erschweren – und damit auch das fein nuancierte Denken.
Die Kunst liegt darin, bewusst und situationssensibel mit Sprache umzugehen – statt pauschal zu vereinfachen oder zu neutralisieren.