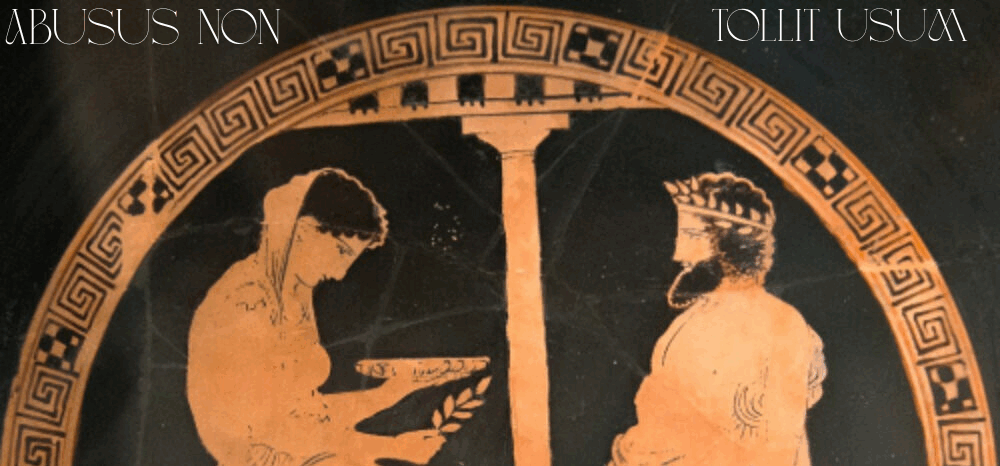Die These, dass sich in modernen Gesellschaften ein „Geldadel“ herausbildet, der ähnliche Funktionen übernimmt wie der historische Geburtsadel im Feudalismus, ist keine neue, aber sie gewinnt im Zeitalter der Tech-Milliardäre neue Brisanz. Diese Annahme lässt sich aus soziologischer, historischer und politisch-ökonomischer Perspektive untersuchen. Hier einige zentrale Punkte dazu:
Von der Feudalherrschaft zum Tech-Adel? Eine kritische Betrachtung moderner Machteliten
Einleitung
Die Französische Revolution von 1789 markierte den Anfang vom Ende der feudalen Ordnung in Europa. Die Macht des Geburtsadels wurde erschüttert, die Idee der Gleichheit und Volkssouveränität trat in den Vordergrund. Doch über zwei Jahrhunderte später stellen sich viele Beobachter die Frage: Haben wir den Adel wirklich überwunden – oder hat er nur seine Form verändert? In einer Welt, in der Tech-Milliardäre wie Elon Musk, Jeff Bezos oder Mark Zuckerberg globale Infrastruktur kontrollieren, stellt sich die Frage, ob ein neuer „Geldadel“ an die Stelle des alten Geburtsadels getreten ist. Dieser Essay untersucht die historischen Parallelen, strukturellen Bedingungen und gesellschaftlichen Auswirkungen einer möglichen „neofeudalen“ Entwicklung.
I. Historische Parallelen: Adel einst und jetzt
Der Geburtsadel des Ancien Régime basierte auf vererbtem Status, exklusiven Privilegien und direkter politischer Macht. Er dominierte Landbesitz, Militär und Verwaltung. Auch wenn die heutige Gesellschaft formal auf Gleichheit und Meritokratie basiert, erkennen wir in der Realität neue Eliten, deren Einfluss in ähnlicher Weise das Gemeinwesen durchdringt.
Diese moderne Elite – oft bestehend aus Selfmade-Unternehmern, Erbinnen großer Vermögen oder Gründer*innen globaler Tech-Firmen – kontrolliert zunehmend essenzielle Ressourcen: digitale Kommunikationskanäle, Datenströme, Künstliche Intelligenz, Raumfahrttechnologien und sogar Gesundheitsforschung. Die Art ihrer Macht ähnelt dabei der des Adels in vielerlei Hinsicht: Sie ist erblich, exklusiv, global vernetzt und weitgehend der demokratischen Kontrolle entzogen.
II. Geldadel in der Digitalmoderne: Die neuen Fürsten
Während Adelstitel heute kaum mehr als kulturelle Relikte sind, haben Milliardäre der digitalen Welt reale Macht über unsere Gegenwart und Zukunft. Elon Musk entscheidet mit einem Tweet über Aktienkurse, transportpolitische Strategien und geopolitische Narrative. Jeff Bezos ist nicht nur Gründer des größten Onlinehändlers der Welt, sondern beherrscht mit Amazon Web Services auch zentrale digitale Infrastrukturen. Peter Thiel agiert an der Schnittstelle zwischen Technologie, Geheimdiensten und Ideologie. Mark Zuckerberg kontrolliert mit Meta die Plattformen, auf denen ein Großteil der politischen Öffentlichkeit stattfindet.
Diese Akteure operieren jenseits nationalstaatlicher Grenzen. Ihre Macht basiert nicht auf Landbesitz, sondern auf Kapital, Code und Kontrolle über Information. Was einst der Fürst mit dem Lehnseid garantierte, ist heute die Plattformbindung, das Datenmonopol oder die Cloud-Infrastruktur.
III. Der Strukturwandel der Abhängigkeiten
In feudalen Gesellschaften war der Bauer abhängig vom Gutsherrn – ökonomisch, rechtlich und sozial. In der digitalen Gegenwart entstehen neue Abhängigkeiten:
-
Menschen arbeiten für Plattformen (z. B. Uber, Amazon) ohne soziale Absicherung.
-
Kommunikationskanäle (z. B. WhatsApp, Facebook, X) sind privatwirtschaftlich kontrolliert.
-
Bildung, Gesundheit und Mobilität sind zunehmend digitalisiert – und damit von den Infrastrukturen weniger Konzerne abhängig.
Diese Entwicklungen lassen sich als Elemente eines „digitalen Feudalismus“ deuten, in dem Nutzerdaten das neue Lehen und Algorithmen die neuen Herrschaftsinstrumente sind.
IV. Gegenkräfte und Ambivalenzen
Trotz dieser Konzentration von Macht gibt es wesentliche Unterschiede zum historischen Feudalismus: Moderne Demokratien verfügen über Institutionen, die – zumindest in der Theorie – die Macht der Eliten einschränken können: Steuerpolitik, Kartellrecht, Datenschutzregulierungen, öffentlich-rechtliche Medien und eine kritische Zivilgesellschaft. Auch die Vorstellung von Leistung und Innovation als Grundlage von Reichtum unterscheidet den Geldadel vom Erbadel.
Gleichzeitig aber sind diese Gegenkräfte oft schwach oder durch Lobbyismus beeinflussbar. Die Fähigkeit multinationaler Konzerne, sich nationalen Gesetzen zu entziehen, erschwert die politische Regulierung. Zudem schaffen private Stiftungen, Think Tanks oder gar eigene Sicherheitsdienste alternative Machtzentren.
V. Ausblick: Eine postdemokratische Zukunft?
Die entscheidende Frage lautet: Bewegt sich unsere Gesellschaft in Richtung einer postdemokratischen Ordnung, in der demokratisch gewählte Institutionen de facto hinter wirtschaftlicher Macht zurückstehen? Oder gelingt es, einen digitalen Gesellschaftsvertrag zu etablieren, der Gemeinwohl und Innovation verbindet?
Ein solcher Vertrag müsste zentrale digitale Infrastrukturen als öffentliches Gut behandeln, Reichtum stärker besteuern, Bildung demokratisieren und Daten als kollektive Ressource begreifen. Andernfalls besteht die reale Gefahr, dass die Versprechen der Aufklärung – Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – durch die Realität des digitalen Feudalismus abgelöst werden.
Fazit
Die Ablösung des Geburtsadels durch demokratische Institutionen war eine historische Errungenschaft. Doch Macht hat ihre Form geändert, nicht ihr Wesen verloren. In der Figur des Tech-Milliardärs kristallisiert sich eine neue Klasse heraus, die über Ressourcen, Netzwerke und Einfluss verfügt, wie es früher nur Monarchen taten. Ob die Gesellschaft dem entgegenwirkt oder sich erneut einer Form struktureller Herrschaft beugt, bleibt eine der zentralen politischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.